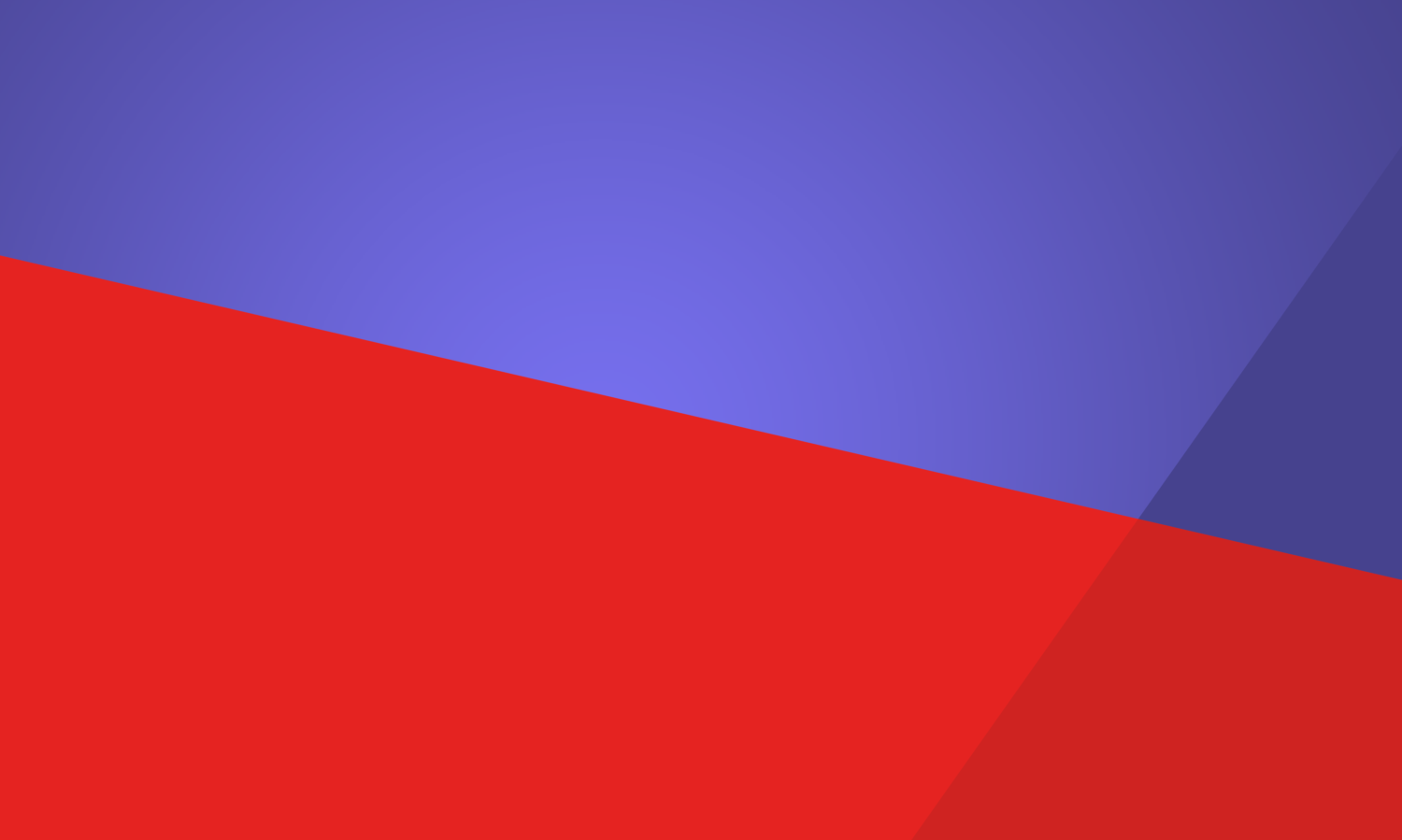Die sächsische Staatsregierung hat das Modellprojekt „Aufbau, Erprobung und Etablierung einer flächendeckenden Beratungsstruktur nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz“ ins Leben gerufen. Allerdings berücksichtigen die Angebote des Modellprojektes die mehrfachen Diskriminierungen von Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte bisher nicht. Es fehlt ein geschütztes Beratungsangebot, das sowohl auf ethnische wie auch genderspezifische Diskriminierungen eingeht, denen diese Frauen* im öffentlichen und privaten Alltag, auf dem Arbeits- und Bildungsmarkt sowie bei der politischen Teilhabe ausgesetzt sind.
- Werden Sie für Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte ein geschütztes Beratungsangebot anbieten, das auf die Besonderheit der mehrfachen Diskriminierung eingeht?
- Wie werden Sie ein solches Angebot umsetzen?
| CDU | SPD | GRÜNE | DIE LINKE | FDP | AfD | |
| Bewertung insgesamt |

|

|

|

|

|

|
 |
Die Schaffung eines solchen Beratungsangebotes ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geplant. |
 |
Wir wollen die von uns auf- und ausgebauten Förderungen in diesen Bereichen durch die beiden Förderrichtlinien Integrative Maßnahmen und Chancengleichheit beibehalten und nach dem Bedarf ausbauen. Im Übrigen haben wir extra für die Arbeit mit Frauen mit Migrationshintergrund einen eigenen Posten im sächsischen Doppelhaushalt verankert. Hier liegen besonders Projekte, die die Schnittstelle zwischen Integration und Gleichstellung abdecken. |
 |
Wir unterstützen die Schaffung und Etablierung von Beratungsangeboten für Frauen* mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung. Diese können an bestehende Beratungsangebote wie etwa des Modells zur Antidiskriminierungsberatung als auch bei Asyl- und Migrationsberatung angebunden sein oder es kann ein Austausch beziehungsweise Verweisberatung stattfinden. Dabei müssen entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. |
 |
Wir unterstützen den Aufbau einer flächendeckenden Beratungsstruktur voll und ganz. Dabei werden wir den unabhängigen Beratungsstrukturen immer auch die Möglichkeit bieten, sich weiter zu entwickeln und bisher noch fehlende Beratungsangebote zu ergänzen. |
 |
Ja. Menschen, die diskriminiert werden, bekommen unsere Unterstützung. Diese Unterstützung muss dabei auf die individuelle Diskriminierung zugeschnitten sein, bei Mehrfachdiskriminierung entsprechend auf die einzelnen spezifischen Benachteiligungen. Frauen mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund sind leider oft von Diskriminierungen aufgrund ihres Geschlechts betroffen. Daran möchten wir mit vielfältigen Maßnahmen ansetzen. So sind unter Ihnen beispielsweise überdurchschnittlich viele Analphabeten, denen wir durch individuelle Bildungsangebote helfen müssen, um Chancengerechtigkeit zu ermöglichen. Weiterhin muss jegliches Personal, das mit Geflüchteten zu tun hat, für entsprechende Diskriminierungen sensibilisiert werden. |
 |
Von der AfD haben wir keine Antworten auf unsere Fragen erhalten. |